Schwarze Sonne

Bei Carl Banuschas Eintreffen am Tatort ist nicht nur die Leiche verschwunden; das Phantombild der vermeintlichen Toten im Monbijoupark weist zudem eine große Ähnlichkeit mit Banuschas chilenischer Frau Anna auf. Diese glaubt an den indianischen Mythos eines Dämons, der Jungfrauen betört, entführt und ermordet. Trotz der unauffindbaren Leiche, trotz der unerreichbaren Anna – Ein Mythos ist ein Mythos. Oder doch nicht? Felix Mennens Krimi 'Schwarze Sonne' treibt ein vertracktes Spiel mit Wahrheit und Wahnsinn. Das schön gestaltete Buch (Bon Bon Büro, Berlin) kommt als Hardcover in Leinen gebunden.
Taschenbuch: 176 Seiten
Verlag: dtv Verlagsgesellschaft (1. März 2014)
ISBN-13: 978-3423215039
PROLOG

Die Frisbee schwebte glitzernd durch die Strahlen der tief stehenden Sonne auf Tobi zu. Er trabte ein paar Schritte nach hinten, langsam senkte sich die Scheibe, und geschmeidig sprang der Junge nun aus dem Rückwärtslauf hoch, um sich die Frisbee lässig aus der Luft zu pflücken. Die Füße wieder auf dem Boden, sah Tobi zu der jungen Frau, die weiter unten, zur Spree hin, auf der Wiese lag. Sie hatte es nicht gesehen. Sie nahm überhaupt keine Notiz von ihnen, von Tobi und seinem Kumpel Malte, mit dem er sich an diesem Morgen im Monbijoupark seit gut zehn Minuten die Frisbee hin- und herwarf. Von irgendwoher drang leise das Spiel einer akustischen Gitarre. Eine traurige Melodie. Die vom Wind durch die Luft geweht wurde. Richtung Westen zog ein Flugzeug einen Kondensstreifen am blauen Himmel entlang.
Es war bereits der dritte außergewöhnlich warme Tag, gegen Mittag wurden 26 Grad erwartet. Und das bereits eine Woche vor Ostern, Anfang April. Die beiden Jungs hatten Schulferien. Und Tobi hatte sich gleich nach dem Frühstück mit seinem besten Kumpel im »Monbi« verabredet. Es war noch nicht viel los um diese Uhrzeit. Oberhalb der Wiese schob eine zierliche blonde Frau einen großen Kinderwagen langsam durch den Park. Sie war in ein Buch vertieft, das aufgeklappt auf dem Griff des Wagens lag. Auf demselben Weg saß ein junger Mann auf einer der Bänke. Er trug ein schickes dunkles Jackett, auf seinen Knien war ein Laptop aufgeklappt, in das er in Gedanken versunken etwas tippte. Unterhalb der Wiese trottete ein untersetzter Mann die Promenade entlang. Er hatte den Kopf auf den Boden gerichtet, wie ein kleines Kind. Ein Bewohner des Behindertenheims, wusste Tobi und sah, wie der Mann nun auf die Wiese bog und auf die Sonnenbadende zusteuerte, bei ihr stehen blieb, sie vermutlich um eine Zigarette oder irgendwas anschnorrte, um dann kopfschüttelnd weiterzulaufen, die Wiese hinauf, zwischen ihm und seinem Kumpel durch, und zielstrebig auf den Mann zu, der da mit seinem Laptop auf den Knien noch immer auf der Bank saß und sich gerade eine Zigarette ansteckte.
Tobi warf die Scheibe zurück und sah wieder zu der Sonnenbadenden. Sie hatte langes, schwarzes Haar, dunkle, fast bronzefarbene Glieder, die in einem türkisfarbenen Badeanzug steckten. Ihre Gegenwart machte den vierzehnjährigen Jungen nervös, erregte ihn. Währenddessen segelte die Frisbee auf seinen Kumpel Malte zu, der nun wie ein Torero der Scheibe im letzten Moment auswich, sie packte und mit einer Drehung um die eigene Achse gleich wieder zurückschleuderte. Der Wurf ging daneben und die Frisbee segelte in einem Bogen an Tobi vorbei und genau auf die Schöne am Ufer zu. Der Junge setzte seine schlaksigen Glieder in Bewegung, rannte der Scheibe hinterher. Doch die Frisbee senkte sich bereits, streifte langsam übers Gras, um dann, ganz sanft, genau auf dem ausgestreckten Arm der Sonnenbadenden zu landen.
Im selben Moment hatte Tobi die Scheibe eingeholt. »Entschuldigung«, keuchte er. Aber die Frau reagierte überhaupt nicht. Sie lag so reglos da wie die Frisbee auf ihrem Arm. Ihre Augen wurden von einer schwarzen Sonnenbrille bedeckt. Ihr Haaransatz war ungewöhnlich tief, wuchs fast mit den dichten, schwarzen Augenbrauen zusammen. Von weitem hatte Tobi sie für eine Südeuropäerin gehalten, eine Italienerin oder Türkin. Doch diese Frau sah anders aus. Wie eine Indianerin, dachte Tobi. Und jetzt sah er, dass sie keinen Badeanzug, sondern einen eng anliegenden Unterwäsche-Zweiteiler trug, mit dem sie sich einfach so ins Gras gelegt hatte.
Tobis Augen wanderten ihren schlanken Hals hinab, über ihre dunkle, fast bronzefarbene Haut, die Träger ihrer Unterwäsche entlang, über den glitzernden, türkisfarbenen Stoff, über die sanfte Wölbung ihres Busens, über das kleine Stück nackter Haut zwischen Oberteil und Slip, der spitz zwischen ihren Beinen zusammenlief, sich über ihre Scham spannte – den Blick freigab auf ihre langen, bronzefarbenen Schenkel im Gras. Tobi spürte ein nervöses Kribbeln in seinen Eiern. Wie ein Magnet haftete sein Blick auf ihrem reglosen Körper, saugte jedes Detail in sich auf: ihre vollen, dunkelroten Lippen, deren Mundwinkel einen leichten Schlenker nach oben machten, die kleinen Beulen, die ihre Brustwarzen in den türkisfarbenen Stoff drückten, die Kerbe zwischen ihren Beinen.
Aus der Ferne hörte er das Gitarrenspiel. Vom Wind durch die Luft geweht, in sein Ohr geflüstert. Diese traurige Melodie. Sprach zu ihm. Sehnsüchtig. Lockte ihn. Verführte ihn. Zwang ihn, ganz tief hinabzusehen, in seine unbefleckte vierzehnjährige Seele, und sich einzugestehen: Er würde alles tun für einen Kuss, für eine Berührung – nur für ein Lächeln von ihr.
»Was geht?« Plötzlich stand Malte neben ihm.
Tobi wandte den Blick von der Frau und sah verwirrt in das picklige Gesicht seines grinsenden Freundes. Malte hatte gerade eindeutig die Stimmung versaut. Tobi zuckte mit den Schultern. »Ich glaube, sie schläft.«
Malte beugte sich hinunter. »Entschuldigen Sie«, sagte er und griff nach der Frisbee auf ihrem Arm. Die Frau reagierte noch immer nicht. Die Jungs sahen sich unsicher an. Malte beugte sich erneut zu der Frau runter, winkte mit einer Hand vor ihren Augen: »Hallo …? Hallo!«
Keine Reaktion. Malte sah fragend zu Tobi, der inzwischen langsam um die Frau herumgeschlichen war, vor ihren Füßen stand und angeekelt zwischen ihre Beine starrte: Da war Blut! Sie läuft aus, dachte er. Hat ihre Tage, dachte er.
In diesem Moment fasste Malte nach der Sonnenbrille der Frau und hob das schwarze Horngestell vorsichtig von ihrer Nase. Entsetzt starrten die Jungs in ihre reglosen schwarzen Augen. Ein aufgescheuchter Käfer krabbelte aus ihrem rechten Nasenloch.
Tobis Magen krampfte sich zusammen. Malte schrie. Im Hintergrund stoppte das Gitarrenspiel abrupt.
TAG EINS
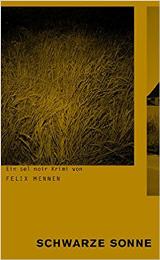
Cover der Erstausgabe
Carl Banuscha schreckte hoch. Wie vom Schrei geweckt. Eine Haarsträhne klebte auf seiner Stirn, er wischte sie nach hinten. Seine Schläfe, auf der er gelegen hatte, war nassgeschwitzt. Gott sei Dank bloß ein Traum, dachte er und betrachtete seine schweißglänzenden Fingerkuppen. Er strich sich mit der ganzen Hand über die feuchte Schläfe, fuhr mit seinen Fingern wie mit einem Kamm durch das kurze, nasse Haar an den Seiten, wischte den Schweiß in den Nacken.
Banuscha hielt sich den Kopf. Sein Schädel brummte, wie jeden Morgen in den letzten Wochen. Benommen sah sich der Kriminalkommissar in dem großen, hellen Zimmer um. Das war nicht sein Zimmer. Es war Franks Zimmer, das Wohnzimmer seines besten Freundes, in dem er sich befand. In dem er auf der Couch lag, unter einer braunen Wolldecke, nackt, wie er jetzt sah, als er die Decke zurückschlug und sich mühsam aufrichtete.
Was machte er hier? Wieso war er nicht zu Hause, bei Anna, seiner Frau … Plötzlich traf ihn der Schmerz wie ein Schlag in den Magen. Für einen Moment blieb ihm die Luft weg: Er hatte kein Zuhause mehr! Kein gemeinsames mit Anna. Er war daraus geflüchtet, vor den ständigen Streitereien mit ihr. Er ertrug das nicht mehr, ihr so fremd zu sein.
Er presste die Augen zusammen, schlug die Hände vors Gesicht, als ob er weinen müsste, spürte einen Kloß im Hals. Doch er riss sich zusammen, atmete tief durch, nahm die Hände runter, öffnete die Augen, blickte zu der Schachtel Zigaretten vor ihm auf dem Beistelltisch, griff danach, wollte sich eine anstecken, gegen den Schmerz. Da fiel ihm ein, dass er gar nicht mehr rauchte. Und er wunderte sich, woher dann die Zigaretten kamen: Hatte Frank sie hier liegen lassen, bevor er in den Urlaub gefahren war? Er erinnerte sich nicht mehr.
Banuscha schüttelte den brummenden Kopf und stand schließlich auf, wankte ins Bad, geradewegs in die Duschkabine, drehte das Wasser auf, ließ es auf seine Schädeldecke prasseln, heißer Regen. Er seifte sich ein, erst Beine und Arme, dann Rücken und Brust, dann seinen Po, seine Eier, seinen Schwanz. Er überlegte, ob er sich einen runterholen sollte – gegen den Schmerz, gegen sein Verlangen nach ihr. Und er schäumte bereits seinen Schwanz auf, wütend, trotzig. Doch der Schmerz saß zu tief: Es fühlte sich an wie ein lebloses Stück Fleisch, was er da in seiner Hand hielt.
Er spülte den Schaum von seinem Körper und trocknete sich vor dem beschlagenen Spiegel ab. Er öffnete die Tür, um die feuchte Luft hinaus- und trockene hereinzulassen. Er kämmte sich das blonde Haar, das Jahr für Jahr ein bisschen dünner wurde. Dieses Jahr wurde er vierzig. Ein Jubiläum, auf das er gerne verzichten würde. Sein Vater wäre dieses Jahr siebzig geworden – hatte sich aber bereits vorher zu Tode gesoffen.
Banuscha sah in den Spiegel, das Kondenswasser wich allmählich vom Glas, gab den Blick auf sein Gesicht frei. Etwas irritierte ihn darin, in seinem Gesicht: Seine Nase wirkte irgendwie größer. Er wischte mit dem Handtuch über den Spiegel, beugte sich vor, mit dem Gesicht ganz dicht vor das Glas, betrachtete seine Nase. Sie war geschwollen. Er wollte gerade daran fassen – als plötzlich eine Tür zuknallte. Erschrocken wandte er das Gesicht ab, sah aus der offenen Badezimmertür. »Anna?«, rief er in den Flur – und wusste selbst nicht warum. Warum sollte sie hier sein? Bei Frank. Wohin er vor ihr geflüchtet war.
Er schlug sich das Handtuch um, trat aus dem Bad und ging zurück ins Wohnzimmer. Die Balkontür stand offen. Hatte sie die ganze Nacht offengestanden? Er erinnerte sich nicht mehr. Warme Luft wehte hinein – ungewöhnlich warme Luft, für einen Morgen, Anfang April. Er sah nach gegenüber, zu seinem Nachbarn, der ja eigentlich Franks Nachbar war, der ihm aber bereits vertraut war, weil der Mann immer da saß, vor einem Computerbildschirm; bei Tag und bei Nacht hockte er davor, hackte auf die Tastatur ein. Was immer sein Nachbar da trieb, es war ein einsamer Job – und Banuscha fühlte sich plötzlich mit dem Mann verbunden, in seiner Einsamkeit.
Da fing sein Handy auf dem Beistelltisch an zu plärren: »Novocaine for the Soul« von den Eels – Annas und seine Hymne, als sie sich vor zehn Jahren kennenlernten –, vor ein paar Wochen für zwei Euro fünfzig auf sein Handy geladen. In einem Anflug von Sentimentalität, als subtile Botschaft an die Anfänge ihrer Liebe. Doch Anna hatte nur das Gesicht verzogen. Er erreichte sie nicht mehr. Er spürte das. »Novocaine for the Soul« – ihre Seele war wie taub. Für ihn.Banuscha griff sich das plärrende Telefon, sah auf das Display: seine Dienststelle. Ein neuer Fall, dachte er sofort. Genau das, was er jetzt brauchte. Ablenkung, etwas gegen den Schmerz. Ein Anästhesiemittel für
seine Seele. Er klappte sein Handy auf. Das Geplärre verstummte abrupt, dafür hörte er Zoras hektische Stimme an seinem Ohr – seine Chefin rief höchstpersönlich bei ihm an, fragte, wie’s ihm geht.
»Gut«, sagte er und schloss die Balkontür.
»Ich weiß, du hast diese Woche noch Urlaub«, sagte Zora, »aber unser Team hat Bereitschaft, wir haben da eine Frauenleiche im Monbijoupark …«
Im Monbijoupark – dieser Ort rief ein ungutes Gefühl bei Banuscha hervor, wie die Erinnerung an einen bösen Traum. Er versuchte, sich an den Albtraum, aus dem er vorhin erwacht war, zu erinnern. Doch da war bloß ein großes, schwarzes Loch.
*
Die Sonne blendete Banuscha, als er aus der S-Bahn-Unterführung trat. Sein Schädel brummte immer noch und er hatte seine Sonnenbrille im Wagen gelassen, ärgerte er sich und hielt sich eine Hand zum Schutz gegen die Sonne an die Stirn, blickte sich um: Gegenüber von ihm standen die Säulen der Alten Nationalgalerie am Spreeufer Spalier, auf dem Wiesenstück links von ihm entdeckte er die Kollegen von der Spurensicherung, die in ihren weißen Overalls das Parkgelände absuchten. Und da erspähte Banuscha auch Gerd Minack, den bulligen Gerichtsmediziner. Die Fäuste in die breite Hüfte gestemmt, seinen kahlen, runden Schädel zu Boden gerichtet, stand er etwas verloren inmitten des Treibens auf der Wiese.
Eine Hand an der Stirn, bahnte sich Banuscha einen Weg durch die Absperrung. Im Vorbeigehen grüßte er die Kollegen, lief zu Gerd, der sich nachdenklich über seine Glatze strich, während er immer noch auf das Stück Wiese zu seinen Füßen blickte, auf dem vier kleine, schwarze Spurentafeln standen, mit den weißen Ziffern 1 bis 4.
»Dachte, du bist noch beurlaubt«, sagte Gerd, ohne aufzusehen.
»Dann wär ich ja wohl kaum hier.« Banuscha wischte sich mit dem Handrücken Schweiß von der Stirn. So eine Hitze Anfang April hatte er in Berlin noch nie erlebt. Er hätte besser einen Leinen- als einen Schurwollanzug gewählt.
»Wie geht’s Anna?“ Gerd sah auf, blickte ihn mit seinen kleinen, dunklen Augen, die stets ein wenig unruhig umherwanderten, an.
»Hab sie gerade zum Flughafen gebracht. Sie hat einen Dreh in Paris«, log er. Tatsächlich hatte er seine Frau seit ein paar Tagen überhaupt nicht mehr gesehen. Nach ihrem letzten heftigen Streit war er bis auf weiteres zu Frank gezogen. Aber das ging niemanden etwas an. Der Kommissar wollte den Schein wahren. Auch wenn Gerd nicht dazugehörte: Einige seiner Kollegen belächelten Banuschas Leben an der Seite eines Filmsternchens, genau wie seine schicken Anzüge. Alles Neider.
Gerds Augen blieben für einen Moment stehen. »Tut mir übrigens sehr leid mit deinem Vater.«
»Du weißt ja, wie unser Verhältnis war, Gerd«, meinte Banuscha nüchtern.
Gerds Augen wanderten wieder unruhig umher. Ja, Gerd wusste es. Er war für den Kommissar stets so etwas wie ein väterlicher Freund gewesen. Er wusste, dass Banuscha seine ganze Kindheit und Jugend lang vergeblich auf die Anerkennung seines Vaters, eines angesehenen Professors, gewartet hatte. Bis der Herr Professor sich mit der »Doktorandin« aus dem Staub gemacht und ihn, die Mutter und seine jüngere Schwester im Stich gelassen hatte.
»Er war dein Vater«, sagte Gerd.
Banuscha nickte. Den Anblick seines Vaters auf der Intensivstation vor Augen, wo er nach seinem zweiten Herzanfall monatelang im Koma gelegen hatte – von der »Doktorandin« keine Spur; der alte Mann an den Schläuchen, so nah – und doch so weit weg, unerreichbar. Ein Leben lang. Seine jüngere Schwester hatte den Vater bei ihren gemeinsamen Besuchen immer liebevoll gestreichelt, über das lichte, speckige Haar, sein friedliches Gesicht. Er konnte das nicht.
»Wenn du mit jemandem darüber sprechen möchtest.« Gerd sah ihn an, seine Augen wanderten unruhig umher. Banuscha antwortete nicht. Hatte plötzlich einen Kloß im Hals. »Du weißt, du kannst mich jederzeit anrufen«, fügte Gerd hinzu.
Banuscha quetschte bloß ein Lächeln raus, dankbar für Gerds Mitgefühl. Etwas, das er bei Anna in letzter Zeit so sehr vermisst hatte: ein Gefühl. Für ihn. Der Kloß in seinem Hals wurde dicker. Gerne hätte er sich Gerd anvertraut, ihm von seinen Gefühlen beim Anblick seines dahinsiechenden Vaters erzählt. Gerne hätte er Gerd auch von seiner dahinsiechenden Ehe erzählt. Wie es sich anfühlte, am Morgen auf der Couch in einer fremden Wohnung zu erwachen – weil er Annas Nähe nicht mehr ertrug, ihre Abwesenheit in seiner Nähe. Doch besser, er behielt seine Probleme für sich, dachte er. Zu Recht könnte ansonsten infrage gestellt werden, ob er momentan überhaupt in der Verfassung war, eine Ermittlung zu leiten. Und er wollte jetzt eine Ermittlung leiten. Wenn um ihn herum seine kleine Welt aus den Angeln brach, wollte er wenigstens seinen Job machen. Das Einzige, was ihn noch zusammenhielt.
»Wir kommen schon klar«, log er und wischte sich erneut mit dem Handrücken Schweiß von der Stirn – überlegte für einen Moment, seine Anzugsjacke auszuziehen, zog es dann aber vor zu schwitzen. Er wollte sich keine Blöße geben, musste die Fassade aufrechterhalten!
Er deutete auf das Stück Wiese mit den Spurentafeln vor Gerd: »Ist die Leiche schon weg?«
»Es gibt keine Leiche.«
»Ah«, machte Banuscha – ein unschuldig klingender Ausruf des Erstaunens, den er sich von seiner Frau angewöhnt hatte. »Und was machen wir dann hier?« Er blickte Gerd amüsiert an.
»Hier soll sie gelegen haben.« Gerd zeigte auf die Spurentafel mit der Ziffer 1: »Da haben wir auf alle Fälle etwas Blut gefunden. Vermischt mit Sekret.«
»Sekret?«
»Von ihrer Vagina, möglicherweise auch Sperma.«
Banuscha nickte. Sex, dachte er, immer geht es nur um Sex. Er ging in die Hocke, betrachtete die Stelle. Das Gras drum herum war platt gelegen. An ein paar Halmen neben dem schwarzen Täfelchen sah er etwas Rötliches kleben, das Blut … Plötzlich stieg ihm ein vertrauter Geruch in der Nase.
Er beugte sich über den Boden, schnupperte über dem Gras. Kein Zweifel. Es ist ihr alter Geruch, ihr Anfangsgeruch. Der Geruch, in den er sich verliebt hatte, wie in alles an ihr. Paris, dachte er sehnsüchtig. Und plötzlich traf ihn der Schmerz wie ein Stich ins Herz: Wie glücklich sie damals waren! Und heute? Ertrug er ihre Nähe nicht mehr – sein Verlangen nach ihr, in ihrer Nähe.
»Alles in Ordnung mit dir?« Gerd. Hatte sich zu ihm runtergebeugt.
»Chanel No. 5«, sagte Banuscha (er sprach es französisch aus: »numéro cinq«, wie er es von Anna gelernt hatte) und stand wieder auf. Schwindel, Sternchen vor den Augen – die Sauferei machte ihm zu schaffen.
Gerd sah ihn fragend an.
»Meine Frau hat das früher mal benutzt«, erklärte Banuscha.
Gerds Augen wanderten unruhig umher, bis sie plötzlich stehen blieben und unterhalb von Banuschas Augen einen Punkt fixierten, sodass der Kommissar nun ebenfalls dorthin schielte.
»Was ist mit deiner Nase passiert?«, fragte Gerd.
Banuscha erinnerte sich: Vorhin im Bad war ihm aufgefallen, dass sie irgendwie größer war, geschwollen. Vorsichtig fasste er sich daran.
Gerd machte einen Schritt auf ihn zu, um Banuschas Nase besser betrachten zu können. »Nimm mal die Pfoten weg«, sagte er.
Banuscha tat, wie ihm befohlen, und bevor er ausweichen konnte, tippte Gerd mit dem Zeigefinger gezielt auf einen Punkt auf dem Nasenrücken. Banuscha schrie vor Schmerzen.
»Gebrochen«, meinte Gerd trocken. »Mich wundert, dass du überhaupt etwas riechst.«
Banuscha macht einen Schritt zurück, fasste sich wieder an die Nase, diesmal zum Schutz.
»Biste irgendwo gegengelaufen?«, fragte Gerd.
Wo gegengelaufen, dachte Banuscha. Wogegen war er mit seiner Nase gelaufen? Hatte er geschlafwandelt? Sein Blick schweifte durch den Park. Da war es wieder, dieses ungute Gefühl, an diesem Ort. Wie die Erinnerung an einen Albtraum. War er schon mal hier gewesen? In seinem Traum, heute Nacht … Er konnte sich nicht erinnern. Da war bloß das große, schwarze Loch, das ihn am Morgen ausgespuckt hatte. Oder träumte er immer noch? War er jetzt erst im wahren Albtraum erwacht: seinem eigenen kaputten Leben?
Er nahm die Finger von der Nase. »Hab mich beim Duschen gestoßen«, log er.
Gerd sah ihn an.
»Hab gar nicht gemerkt, dass es so schlimm ist«, grinste er.
Gerds Augen wanderten unruhig umher. Da sah Banuscha aus dem Augenwinkel Anke Kiesling auf sie zukommen, das Nesthäkchen im Team von Banuschas Mordkommission. Er drehte sich einmal um die eigene Achse, hob theatralisch die Arme, kam sich vor wie Al Pacino, der einen Kommissar spielt: »Aber wo zum Kuckuck soll die Frau denn hin sein? Am helllichten Tag! Mitten im Park!« Er sah Gerd mit großen Augen an.
Der Gerichtsmediziner rieb sich ratlos die Glatze.
»Hallo, Carl.« Kiesling war zu ihnen getreten.
Er drehte sich überrascht zu ihr, als ob er sie noch gar nicht bemerkt hätte. Sie stand genau vor der Sonne, sodass er sich die Hand an die Stirn halten musste.
»Schön, dass Sie wieder da sind!« Ihre großen, hellblauen Augen musterten ihn forsch, mit so einem kleinen Funkeln, verheißungsvoll.
Sie sah gut aus, in der engen, dunkelblauen Jeans und dem engen, langärmeligen T-Shirt – hellblau, in der Farbe ihrer Augen. Darüber spannte sich das breite schwarze Trägerband einer sportlichen Umhängetasche quer zwischen ihren Brüsten durch – großen Brüsten, die so gar nicht zu ihrem sonst eher zierlichen Körper passten …
»Was ist das?« Eine Hand immer noch an der Stirn, zeigte er auf den Beutel in Kieslings rechter Hand, in dem eine schwarze Sonnenbrille steckte. Sie sah fast aus wie seine, die er im Wagen liegen gelassen hatte. Er hätte sie sich am liebsten gleich aufgesetzt.
Kiesling hielt den Beutel hoch. »Eine Sonnenbrille.« Sie lächelte keck, mit ihrem kleinen, süßen Mund. Feine Äderchen schimmerten dabei unter der blassen, fast weißen Haut durch, die sich über ihre hohen Wangenknochen zog. Ihr blondes Haar war streng zu einem Zopf nach hinten gebunden. Sie war wie ein blonder Gegenentwurf zu Anna, Banuschas chilenischer Frau mit indianischen Vorfahren. Und der Kommissar stellte sich vor, wie diese blasse, fast weiße Haut sich um ihre großen Brüste spannte, feine Äderchen zog …
Dann sah er sie plötzlich vor sich, ihre entblößten Brüste, weiß und groß, geknetet von seinen gierigen Händen; er sah seine Zunge, die wild an ihren hellrosa Brustwarzen leckte – wie Erinnerungsfetzen schossen ihm diese Bilder durch den Kopf, als ob es tatsächlich stattgefunden hätte … Aber das konnte unmöglich sein! Für einen Moment hatte er das Gefühl, das Gleichgewicht zu verlieren. Als ob der Boden unter seinen Füßen schwankte. Er musste mit der Sauferei aufhören!
»Das sehe ich auch«, sagte Banuscha schroff und wischte sich Schweiß von der Stirn.
Kiesling zuckte zusammen. Es tat ihm sofort leid. Sie konnte ja nichts dafür. Dass er sich im Grunde nach nichts mehr sehnte, als seine Nase in ihre großen, weißen Brüste zu stecken und sich an ihren Nippeln festzusaugen.
Kiesling räusperte sich und zeigte auf die Spurentafel Nummer 3: »Die Brille lag dort. Sie gehörte der Frau.«
Das Funkeln in ihren Augen war verschwunden – auch das tat ihm leid …
»Dem verschwundenen Leichnam?« Er versuchte ein Lächeln.
Doch jetzt war sie ganz ernst, seine blasse, junge Kollegin: »Die beiden Jungs haben sie ihr abgenommen. Als sie nachsehen wollten, ob sie noch lebt.« Kiesling blickte in Richtung der beiden schlaksigen Teenager, die bei einem Mannschaftswagen an der Uferpromenade standen und nervös dreinschauten.
»Und was war dort?« Er zeigte auf die Spurentafel mit der Nummer 2.
»Ein Zigarettenstummel«, sagte Gerd. »Ist bereits auf dem Weg ins Labor, zusammen mit einer Probe von den Blut- und Sekretspuren …«
»Und das da drüben?« Banuscha zeigte auf die Spurentafel Nummer 4, die ein paar Schritte weiter neben einer milchigen Lache platziert war.
»Cornflakes«, sagte Gerd. »Von einem der Jungs.« Banuscha nickte. Sprach dafür, dass die beiden tatsächlich eine Leiche – oder etwas, was sie dafür gehalten hatten – gesehen hatten.
derschneemann.net, Juli 2015
VIRUS, Offenbach, Mai 2014
NOBILIS, Hannover, Mai 2014
WILD Magazin, Köln, R.-H. Tarenz, 26.März 2014
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der GEW, 15.März 2014
Stuttgarter Nachrichten, Thomas Klingenmaier, 5.April 2012
schmerzbach.blogspot.de, Jannis Plastargias, 19.Dezember 2012
Gützow Journal
Gabal.de, Hanspeter Reiter